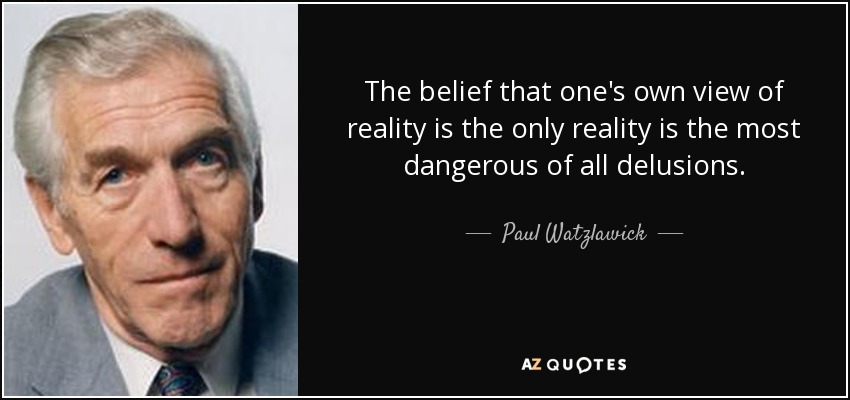Zweimal waren Caro und ich in einem – hier nicht näher bezeichneten, man will ja nicht nachtreten – Hotel, einmal, weil Caro da unbedingt hinmusste, dann noch einmal, alldieweil wir beide nicht glauben konnten, was wir beim ersten Male erlebt hatten – und siehe, es kam schlimmer. Dann habe ich allhier aufgeschrieben, was wir so erlebt hatten, und nachdem wir zweimal etliche hundert EURO für schöne Zimmer mit lausigem Service und grottigem Essen ausgegeben hatten, war meine Wortwahl nicht die freundlichste, Worte wie „beschissen“ oder „unter aller Sau“ fielen da, und die beschrieben exakt Vieles des Erlebten, aber daneben fanden sich auch Wertungen wie „blitzsauber“, „tadellos in Schuss“, „schnelles und freundliches Einchecken“, usw. Dabei – das sei noch gesagt – habe ich – das wäre je auch ganz schlechter Stil – niemals geschrieben „Der Service ist beschissen.“, ich habe vielmehr dezidiert geschrieben: „Vorgefallen sind A, B, C, und D … und daher empfanden wir den Service als beschissen.“ So hatte ich unter anderem geschrieben, dass die Zufahrt zur Hotelgarage so schmal sei, dass man mit modernen, großen Autos – von denen ich eines fahre – kaum durchkäme, ich musste die Spiegel einklappen, um nicht anzudotzen; ich hatte geschrieben, dass der angeblich frische Hummer auf der Speisekarte – der, das bereits verdächtig, aus irgendwelchen Gründen in der Küche vorab zerlegt werden musste – nie und nimmer frisch war, sondern irgendein Tiefkühl-Dingsda; ich hatte geschrieben, dass wir über eine Stunde auf den Zimmerservice warten mussten; ich hatte geschrieben, dass auf der Speisekarte „hausgemachte Rösti“ angeboten wurden, dass ich beim Kellner sogar noch nachfragt hatte, ob denn die Rösti tatsächlich hausgemacht seien, was dieser bejahte, was dann kam waren Convenience-Röstinchen frisch aus der Fritteuse; ich hatte geschrieben, dass Caro einen Campari als Aperitif bestellt hatte, man ihr kommentarlos einen Ramazotti servierte, als sie reklamierte sagte man ihr zuerst, dies sei „eine andere Art Campari“ und sodann, „echten Campari“ habe man nicht im Angebot, und das, obwohl er in der Karte stand und – das war der Gipfel – beim Verlassen des Restaurants sahen wir eine fast volle „echte Campari-Flasche“ in der Bar stehen. All das – und noch viel mehr – hatte ich geschrieben und die gesamte Leistung des Service an diesem Abend dann als „unter aller Sau“ bewertet.
Wochen vor der Veröffentlichung besagten Textes auf opl.guide habe ich ihn der Hotel-Direktion zur Kenntnisnahme mit voller Nennung von Ross und Reiter zugesandt (und den Ersten, der behauptet, ich hätte dies in erpresserischer Absicht getan, für eine Nicht-Veröffentlichung ein weiteres grottiges, diesmal aber kostenloses Wochenende erschnorren zu wollen, den zerre ich – bei Gottfried – vor den Kadi, ich lasse meine Reisen niemals von Etablissements bezahlen, über die ich schreibe), weil ich das Haus ja irgendwie schon mag und vielleicht kann solch eine Kritik ja auch helfen, Dinge fürderhin zu verbessern. Was zwei Tage später folgte war der – ich würde sagen, ob dieser Art der Kritik – völlig fassungslose Anruf eines Hoteldirektors und geschäftsführenden Gesellschafters, der wissen und gewiss auch verstehen wollte, wer ich denn sei und was ich denn sei, solche Dinge über sein Haus zu schreiben. Ich hatte bei dem ganzen Telephonat den Eindruck, mit einem durch und durch gebildeten, engagierten, feinfühligen, fachkundigen, nach bestem Vermögen auch weltoffenen Manne zu sprechen, der einfach versuchte, die „Welt“ meines Artikels zu verstehen und es doch nicht vermochte. Wie ich ein Kind der Sechziger verglich er meinen – gewollt nicht einfachen, wer einfache Sätze mag, der lese getrost die Bild-Zeitung, ich will meine Gedanken nicht in Subjekt-Prädikat-Objekt-Zwangsjacken stecken, wer willfährige Hurensprache braucht, der gehe zu den Sprachhuren – hypotaktischen Satzbau mit Martin Walser, ein gewiss viel zu großer und ehrenvoller, so doch ungemein schmeichelhafter Vergleich; doch wie ich ein Kind der Sechziger scheinen Charles Bukowski (die Stadt Andernach hat ihn – Bukowski, nicht den Hoteldirektor – zwischenzeitlich auch mit einer Tafel an seinem Geburtshaus geehrt, Bukowski ist bis heute der meist-geklaute Autor in Imperial-Amerikanischen Buchläden und Barfly ist sowieso Kult; Koinzidenz der Ereignisse: bei seinem legendären Auftritt in der Hamburger Markthalle 1978 – ich war dafür extra nach Hamburg gereist – soff er einen Eisschrank voller Müller-Thurgau leer, und damit wären wir indirekt wieder bei den Problemen besagten Hotels …) und seine literarische Strahlkraft vollends an besagtem Hoteldirektor in der Provinz vorbei gegangen zu sein. Es steht jedermann selbstverständlich frei, meine Sprache, deren partielle Komplexität (Punkte werden heutzutage völlig überbewertet!) und vulgäre Niederungen nicht zu mögen und auch zu kritisieren; während ich beruflich gezwungen bin, das wohlgesetzte, weichgespülte, mainstream-taugliche, politisch korrekte Wort zu wählen nehme ich mir seit Jahren die Freiheit, privat in einer Sprache zu kommunizieren, die aneckt, die nicht jedem gefällt, die provoziert, oder um es mit den Worten Arno Schmidts – mit dem ich mich natürlich nie vergleichen würde – auszudrücken, als er von nämlichem Martin Walser 1953 zur Mitarbeit in der Gruppe 47 eingeladen wurde: „Lassen Se man: ich eigne mich schlecht als literarisches Mannequin.“
Wie ich denn Worte wie „beschissen“ oder „unter aller Sau“ verwenden könne, wollte der Herr Hoteldirektor wissen, und noch dazu in Verbindung mit seinem Hause. Wer ich denn sei, welche Ausbildung ich hätte, mir solcherlei Kritik anzumaßen, was ich denn beruflich täte, und so weiter und so fort. Bereitwillig gab ich dem guten Manne Auskunft, wollte dann aber auf den Punkt kommen und über falsch deklarierte Convenience-Röstinchen, Tiefkühl-Hummer und schmale Hotelgaragen-Einfahrten sprechen. Auf diese Diskussion ließ sich der Empörte überhaupt nicht ein. „Das tut doch hier gar nichts zur Sache!“, sagte er mehrfach. Doch, entgegnete ich, das sei eben die Sache, nichts anderes. Er möge mir doch sagen, wie breit genau seine Garageneinfahrt sei, ich werde ihm dann sagen, wie breit mein handelsübliches Auto sei; er möge mir doch die Rechnung seines Lieferanten für lebende Hummer zeigen, und ich werde mich dann in aller Öffentlichkeit für meinen falschen Eindruck entschuldigen; er möge doch seine Mitarbeiter fragen, um welche Uhrzeit ich das erste Mal telephonisch beim Zimmerservice bestellt hatte und wann wir endlich das Bestellte erhielten. „Das tut doch hier gar nichts zur Sache!“, die Sache sei vielmehr meine Wortwahl und meine in Summe wirklich nicht positive Kritik seines Hauses (wobei – s.o. – ich auch positive Dinge hervorgehoben hatte). Dieses Telephonat war ein Paradebeispiel der gelebten Metakommunikation à la Watzlawick. Ich argumentierte auf der Inhaltsebene, der gute Hoteldirektor auf der Beziehungsebene. Ich wollte über Fakten sprechen, der Hoteldirektor über Sprache und Berechtigung. Der Hoteldirektor war nicht bereit, auf der Faktenebene zu diskutieren (er ging sachlich auf keinen einzigen meiner Kritikpunkte ein); ich hingegen war nicht bereit, auf der Metaebene zu diskutieren und mich zu rechtfertigen, welche Worte ich nutze und welche Berechtigung ich zur Benutzung derselben habe.
Das Gespräch verlief sehr unergiebig, wir waren nicht in der Lage, eine gemeinsame Kommunikationsebene zu finden. Wir beide waren zumindest Akademiker und Gentlemen genug, uns wenigstens nicht zu beschimpfen und zu bedrohen. Zurück blieb beim Herrn Direktor wahrscheinlich Empörung, bei mir Ratlosigkeit, oder, um es mit Wolfgang Niedeckens Übersetzung des alten Cohen-Songs „Famous blue raincoat“ auszudrücken: „Wat schriev mer en su enem Fall?“